Ihre Suchergebnisse:
Allergische Rhinitis (Heuschnupfen)
Ausführliche Informationen zu Ursachen, Diagnose, Symptomen und Therapie von allergischem Schnupfen liefert dieser Elternratgeber der Gesellschaft für Pädiatrische Allergologie und Umweltmedizin e. V. (GPAU), der Trägerin von Allum.
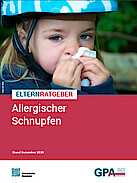 Allergischer Schnupfen
Allergischer Schnupfen
15 – 25 % der Gesamtbevölkerung leiden an einem allergischen Schnupfen. Er ist keine Bagatellerkrankung, sondern kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die Beschwerden beginnen meist im Kindes- und Jugendalter…
zum GPAU-Elternratgeber “Allergischer Schnupfen”
Autor/innen:
Zuletzt aktualisiert: 23.03.2024
